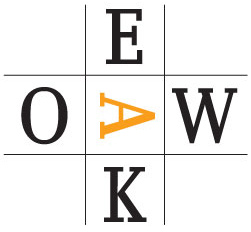Lwiw, die heute westukrainische Stadt, blickt auf eine heterogene Geschichte zurück, die sie Teil ganz unterschiedlicher Nationen hat werden lassen. Diese multikulturelle Vergangenheit prägt die Stadt noch immer, nicht nur ihre Architektur, auch ihre Menschen. Doch da ist auch die heutige Ukraine, eine junge Generation, die längst Teil des modernen Europa geworden ist, und sich doch ganz anders fühlt.
Junge, deutschsprachige Theaterschaffende haben sich auf den Weg gemacht, die ihnen unbekannte Stadt, das unbekannte Land zu betreten und eine erste Begegnung zu wagen. Es gab keine konkrete Aufgabenstellung, aber die Möglichkeit, Projektideen für die Zukunft zu entwickeln.
Die Stipendiaten:
Nora Schlocker:
Bevor ich in die Ukraine gereist bin, las ich einen schönen Satz von Jurko Prochasko. Er beschrieb, dass Lemberg nach dem Krieg wie eine Muschel übrig geblieben war, die ohne das Tier darin, ohne ihren Bewohner, übrig geblieben war. Also hab ich mich auf dieser Reise auf die Suche nach dem neuen Bewohner in der Muschel gemacht. Wollte sehen, wie das neue Tier es sich so eingerichtet hat, wie es lebt. Und ich kann berichten, die Muschel ist ein Schmuckkästchen. Im Frühjahr fallen wahrscheinlich mit den Eiszapfen auch ein paar Jugendstilornamente auf die Straße und ich muss gestehen, ein wenig tat mir das Herz weh beim Anblick des doch auch sehr präsenten Verfalls der Muschelhülle. Doch drin war viel „duscha“, also „Seele“ (wie ich mir hab sagen lassen, ist dieses wichtigste Dostojewskij–Wort in beiden Sprachen, im Russischen und Ukrainischen, das selbe). Diese „Seele“ hat mich sentimental gemacht. Die Muschel scheint ein windstiller Ort zu sein, abgeschirmt und geschützt von einem gewissen Außen, und somit hat sie einiges bewahrt, nach dem ich mich oft sehne. Was das genau ist, kann ich schwer beschreiben. „Duscha“ hat mich nachdenken gemacht, über Identität und Geborgensein, ganz abseits von Grenzen und Ländern und Benennungen. Ein Sehnsuchtsgefühl nach Heimat hat mich angesteckt. Und so war meine Reise in die Muschel auch eine Spurensuche in meinem eigenen Kosmos, ein Versuch einer Selbstrekonstruktion. Am meisten bleibt mir nach dieser Reise ein Satz im Kopf hängen: Auf mein andauerndes Fragen nach der Identiät, nach der Definierung der Traditionen, auf deren Wert in Gesprächen oft und vehement verwiesen wurde, antwortete man mir:“An dem Punkt, an dem man seine Identität findet, ist man tot.“ Dieses „sich in Bewegung befinden“, vor allem in den Köpfen der Künstler die wir getroffen haben, hat mich persönlich am meisten beeindruckt. In der Muschel hatte ich immer das Gefühl, vor uns – und mit uns meine ich die Menschen im Allgemeinen – liegt noch ein großes Stück Weg. Sobald ich aus der Muschel herausgekrochen bin, nach Deutschland zurückgekehrt bin und die erste Aklimatisierung stattgefunden hat, bemerke ich nun diese altbekannte Behäbigkeit, die meine Gedankengänge heimlich rücklings wieder würgt.
Natalie Driemeyer:
Fremde machen sich häufig falsche Vorstellungen von Ländern, deren Vertreter sie nur bei sich zu Gesicht bekommen haben. (Tucholsky)
Eine Grundlage meiner Erwartungen an diese Reise war die Suche nach dem Fremden. Meine darauf folgende Erkenntnis war, dass „das Fremde“ auch in uns als „fremd“ erscheinenden Ländern zumeist nur durch eine starke Selektion der Eindrücke – welche Clichées hervorrufen – existieren kann. Man erstellt Photographien von Orten und Menschen die einem fremd, andersartig vorkommen; der Blick für das Bekannte wird zumeist verschlossen, um eine Enttäuschung auszuschließen.
Weiterführende Auseinandersetzungen, in der Verbindung des Fremden mit dem Eigenen, können besonders in der Theaterarbeit entstehen. Das gleiche Interesse – Theater – basiert auf unterschiedlichen ästhetischen Lehren. In der gemeinsamen Arbeit ukrainischer und deutschsprachiger Theaterleute besteht die Chance, die jeweils eigene Definition von Theater zu erweitern und zu ergänzen.
Jenes, am Anfang der Reise gesuchte Fremde, kann sich zu einem erlebten und gelebten Gemeinsamen entwickeln.